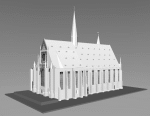|

Mein Blick aus dem Gewandhaus am 6. November
1989
Ein neuer Aufbruch für Wissenschaften in Leipzig
Die Wissenschaft in Leipzig bedarf wieder ihrer Identität. Einst
war sie so anziehend, daß zwei Drittel ihrer Studenten aus dem Ausland
kamen und sodann Anregungen aus dieser Stadt in ihre Heimatländer
nahmen, in die sie weltweit Leipziger Traditionen einbrachten.
Leipzig war als Garten- und Lindenstadt bekannt, als das "Herz
Deutschlands". Wissenschaftler wie Ernst Heinrich Weber, Gustav
Theodor Fechner, August Friedrich Möbius, Rudolph Hermann Lotze
und Alfred Volkmann wirkten gleichzeitig in einer Atmosphäre, die
nicht nur von Persönlichkeiten des Handels und der Wirtschaft geprägt
wurde, sondern auch durch Felix Mendelssohn Bartholdy, Richard Wagner,
Clara und Robert Schumann, Ferdinand David sowie durch die Tätigkeit
von Hermann Härtel, Salomon Hirzel, Anton Philipp Reclam, Heinrich
Brockhaus und Otto Wigand, um nur einige Verleger zu nennen. Dieser
schöpferischen Verflechtung, die im Gewandhaus, im Alten Theater,
in den Kuchengärten und in den Privathäusern in vielen Begegnungen
das Leben bereicherte, ist es zu danken, daß sich die Stadt damals
so produktiv entfalten konnte und später zur Heimat wurde für Paul
Flechsig, Wilhelm His, Wilhelm Wundt, Carl Friedrich Wilhelm Ludwig,
Wilhelm Ostwald, Werner Heisenberg u.v.a..
Heute hat Leipzig das Zehnfache der damaligen Einwohnerzahl, während
sich das geistige Potential nicht verzehnfacht hat. Doch es gibt
heute viele Parallelen zu der damaligen Entwicklung. Leipzig erlebte
jene Blüte erst Jahrzehnte nach dem Krieg von 1813 und den revolutionären
Umwälzungen durch die Leipziger Bürger im Jahre 1830. Nun steht
die Stadt Jahrzehnte nach dem Krieg wieder vor einer Zäsur, in der
sie ihre Schwächen erkennen sollte, um ihre Stärken zu nutzen.
Der qualitativ bedeutsame Unterschied zur Zeit der beginnenden technischen
Revolution besteht darin, daß die damalige, scheinbar unbelastete
Erweiterung auf allen Gebieten das Bewußtsein für deren Folgewirkungen
nicht einschloß. Der Stadt wurde mit schnellem Wachstum (in 30 Jahren
von 100000 auf 500000 Einwohner um 1900) zwangsläufig der fruchtbare
Boden entzogen. Großzügigkeit im Bauen ging einher mit einer Verödung
der geistigen Landschaft. Die gesellschaftliche Integration fiel
damit unaufhaltsam auseinander. Dieser Fehler muß in Zukunft vermieden
werden. Der kulturelle Raubbau, der 1933-1945 einen unrühmlichen
Höhepunkt fand, begann eigentlich schon vor der Jahrhundertwende.
Selbst der sichtbare Beweis der Kulturschande aus neuerer Zeit,
die 1968 erfolgte Sprengung von Universitätsgebäuden und der Universitätskirche
und der Bau eines funktional mißratenen Universitätskomplexes, ist
in diesem Rahmen zu sehen.
Gerade aus dieser Geschichte erwächst die verpflichtende Verantwortung,
im qualitativ neuen Geflecht gesellschaftlicher Ausprägungen Leipzig
wieder eine sorgsame Pflege angedeihen zu lassen. So bedarf es wieder
jenes selbstverständlichen Austausches zwischen verschiedenen Erfahrungsbereichen,
jener sozialen Überschaubarkeit, Kommunikation und weltoffenen Sichtweise,
die im Wechselspiel mit den Messen neue Erfahrungen aufnimmt und
weiter anreichert.
Die Stadt benötigt eine wissenschaftliche Infrastruktur, die sich
ihrer Vorbilder bewußt ist und eigene Wissenschaftsentwicklungen
und Technologien anwendbar macht.
Der tötende Raubbau an der Leipziger Umwelt in den vergangenen Jahrzehnten
zwingt zu der Elementareinsicht, daß Naturverbundenheit der Grundgedanke
der Wissenschaft ist. Das umfassende Verständnis biologischer Bedingungssysteme,
effiziente Energienutzungen und ökologische Verbesserungen sind
einige Themenbereiche, die notwendigerweise wissenschaftlich erarbeitet
werden müssen.
In diesem Sinne gilt die umfassende Herausforderung, daß es bei
allem, was, von wem auch immer, für den Wiederaufbau von Leipzig
getan wird, nicht erneut zerstörerische Widersprüche geschaffen
werden. Wenn Leipzig stark sein kann in seinem Eigenleben, ist es
auch stark für andere.
Wieland Zumpe
Leipzig, den 26. Dezember 1989
|